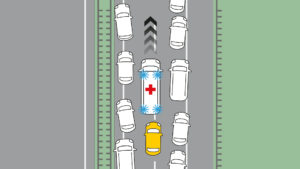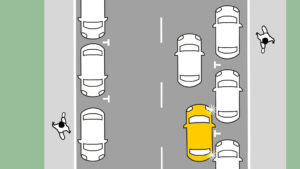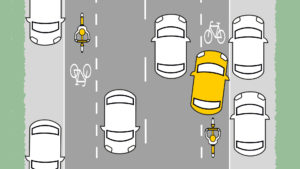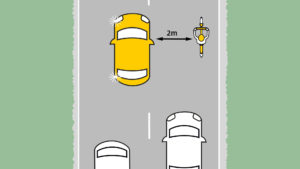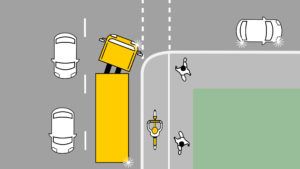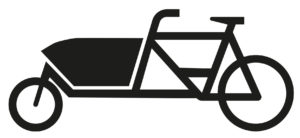1. Ich möchte eine Ansteckung mit dem Corona-Virus vermeiden. Wann darf ich, wann muss ich zu Hause bleiben?
Eine einfache Antwort gibt es nicht. Es ist zwischen verschiedenen Situationen zu unterscheiden:
- Die bloße Befürchtung, sich bei Verlassen der Wohnung möglicherweise mit dem Corona-Virus anzustecken, genügt nicht, damit Sie der Arbeit fern bleiben dürfen. Denn eine nur potenzielle Ansteckungsgefahr – auf dem Weg zur Arbeit oder am Arbeitsplatz – gehört zum allgemeinen Lebensrisiko. Diese trägt jede und jeder Beschäftigte selbst. In vielen Betrieben bestehen jedoch schon heute Regelungen zur Arbeit im Home Office / von Zuhause aus; auf diese kann zurückgegriffen werden. Bitte prüfen Sie jedoch, welche Absprachen ggf. erforderlich sind. Der Corona-Virus kann allerdings auch in Betrieben, in denen bislang kein Homeoffice möglich ist, Anlass sein, über entsprechende Regelungen nachzudenken und entsprechende Möglichkeiten zu prüfen, um die Auswirkungen von Ansteckung und Erkrankungen auf den Betrieb zu minimieren. Fragen Sie zu den Möglichkeiten im Betrieb nach. In Betrieben mit Betriebsrat oder Personalvertretung können zwischen diesen und dem Betrieb Absprachen erfolgen.
- Haben Sie den Verdacht, sich mit dem Corona-Virus angesteckt zu haben – etwa weil Sie z. B. in Kontakt mit einer Person waren, bei der eine Infektion festgestellt wurde – sieht die Rechtslage schon anders aus. Denn beim Vorliegen eines sogenannten vorübergehenden persönlichen Verhinderungsgrundes (§ 616 S.1 BGB) dürfen Sie der Arbeit fernbleiben und bekommen trotzdem ihr Entgelt ausgezahlt, soweit dies nicht durch Tarif- oder Arbeitsvertrag ausgeschlossen wurde. Dieser Verhinderungsgrund liegt u.a. bei einem medizinisch notwendigen Arztbesuch vor, wenn dieser nur während der Arbeitszeit erfolgen kann. Ist zur medizinischen Abklärung eines Corona-Verdachts das Fernbleiben von der Arbeit nötig, muss der Arbeitgeber unverzüglich über das Fernbleiben von der Arbeit informiert werden. Bitte beachten Sie auch die öffentlich zugänglichen Hinweise der Ärzte und Gesundheitsbehörden an Ihrem Wohnort, wie man mit Verdachtsfällen umgehen sollte. Zumeist soll zunächst eine telefonische Information erfolgen und nicht direkt die Arztpraxis aufgesucht werden. Sie lassen sich dann vom Arzt oder anderen aufgesuchten Stelle schriftlich bestätigen, dass eine medizinische Indikation für die Untersuchung bestand. Zur Angabe des genauen Grundes des Arztbesuches – also der aufzuklärende Erkrankung – sind Sie Ihrem Arbeitgeber gegenüber nicht verpflichtet.
- Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Krankheitssymptome haben und dadurch arbeitsunfähig sind, haben aufgrund ihrer Arbeitsunfähigkeit das Recht, der Arbeit fernzubleiben. Das gilt übrigens nicht nur für Corona, sondern allgemein. Die Arbeitsunfähigkeit muss dem Arbeitgeber unverzüglich mitgeteilt werden und es sind auch die sonst bei Arbeitsunfähigkeit im Betrieb geltenden Regelungen einzuhalten. Unabhängig davon sieht das Gesetz vor, dass spätestens nach dem dritten Tag der Arbeitsunfähigkeit dem Arbeitgeber ein ärztliches Attest – also die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung – vorgelegt werden muss. Tarifverträge oder Arbeitsverträge regeln oft die Frist für die Vorlage der AU-Bescheinigung abweichend von der gesetzlichen Grundregel. Zulässig ist sogar – bei Bestehen eines Betriebsrats im Betrieb allerdings nur nach dessen ordnungsgemäßer Beteiligung – eine Regelung der Vorlagepflicht ab dem ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollten die in ihrem Betrieb geltenden Fristen kennen und beachten. Arbeitsunfähig erkrankte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben grundsätzlich für die Dauer von sechs Wochen einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung gegenüber ihrem Arbeitgeber und anschließend auf Krankengeld von der Krankenkasse.
2. Mein Arzt / meine Ärztin vermutet bei mir den Corona-Virus oder hat diesen bereits diagnostiziert. Schulde ich meinem Arbeitgeber eine Information darüber?
Es gibt grundsätzlich keine Pflicht, dem Arbeitgeber oder den Arbeitskollegen die ärztliche Diagnose offenzulegen. Der bzw. die Beschäftigte ist lediglich verpflichtet, dem Arbeitgeber die eigene Arbeitsunfähigkeit anzuzeigen und ihre voraussichtliche Dauer mittels Attest nachzuweisen. Es steht Ihnen natürlich frei, Ihrem Arbeitgeber und den Kollegen trotzdem den Grund Ihrer Arbeitsunfähigkeit mitzuteilen, zum Beispiel um sie zu warnen. Zudem unterliegt eine Vielzahl der gefährlichen und ansteckenden Krankheitserreger – darunter Masern, Polio, Hepatitis B oder Influenza und seit kurzem auch der 2019-nCov (also der neue Corona-Virus) nach dem Infektionsschutzgesetz der behördlichen Meldepflicht. Das bedeutet, dass bei einer Diagnose eines dieser Erreger, der Arzt bzw. die Ärztin unverzüglich unter Angabe von persönlichen Daten der/des Erkrankten dies dem zuständigen Gesundheitsamt mitteilen muss. Dieses verfügt über weitreichende Kompetenzen, die Maßnahmen zur Bekämpfung der Erkrankung – darunter auch im Betrieb des Arbeitgebers – einzuleiten. Nach der kürzlich verabschiedeten Corona-Meldeverordnung müssen die Ärzte nicht nur die tatsächlichen Erkrankungsfälle von Corona, sondern auch Verdachtsfälle den zuständigen Behörden melden.
3. Meine Arbeitgeberin möchte mich auf Dienstreise schicken, ausgerechnet in eine Gegend, über die bekannt ist, dass dort viele an Corona erkranken. Muss ich dorthin reisen?
Die Arbeitspflicht erstreckt sich grundsätzlich auch auf Dienstreisen. Alleine aufgrund der Sorge vor Ansteckung dürfen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine Dienstreise nicht verweigern.
Erwartet der Arbeitgeber die Erbringung der Arbeitsleistung jedoch an einem Ort, an dem das Ansteckungsrisiko offiziell festgestellt wurde, etwa an einem zum Quarantänegebiet erklärten Ort oder in einer Gegend, zu der von Seiten des Auswärtigen Amtes eine offizielle Reisewarnung (nicht zu verwechseln mit einem bloßen Sicherheitshinweis) wegen der Infektionsgefahr vorliegt, kann der/die Arbeitnehmer*in die Dienstreise verweigern (§ 275 Abs. 3 BGB). Beschäftigte müssen grundsätzlich ihre Arbeitsleistung nicht unter Umständen erbringen, die mit erheblichen Gefahren für ihr Leben oder ihre Gesundheit einhergehen. Wer eine Dienstreise unter diesen Umständen verweigert, muss damit rechnen, dass ihr/ihm eine andere Arbeit zugewiesen wird. Selbst wenn das aber nicht passiert, behält man das Recht auf Vergütung (§ 615 BGB).
Unterhalb der Schwelle von Reisewarnungen kann die Weisung, eine Dienstreise anzutreten, trotzdem „unbillig“ sein. Insoweit ist eine Interessenabwägung mit den betrieblichen Belangen des Arbeitgebers vorzunehmen. Bei Zweifeln an der Rechtmäßigkeit der Anweisung einer kurzfristig anstehenden Dienstreise sollte allerdings zunächst das Gespräch mit dem Arbeitgeber gesucht und Kontakt mit dem Betriebsrat, der Personalvertretung oder der Gewerkschaft aufgenommen werden, um sich noch einmal abzusichern.
Für medizinisches Personal oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Katastrophenschutzorganisationen, die gerade zur Bekämpfung von Seuchen in den betroffenen Gebieten eingesetzt werden, gelten abweichende Regeln.
4. Ich komme gerade aus einem Auslandsurlaub zurück. Schulde ich meinem Arbeitgeber eine Auskunft darüber, wo ich war?
Nein, diese Auskunft schulden Sie grundsätzlich nicht. Ein Informationsinteresse des Arbeitgebers könnte höchstens dann bestehen, wenn Sie sich in den Gebieten aufgehalten haben, für die das Auswärtige Amt eine offizielle Reisewarnung wegen der Infektionsgefahr herausgegeben hat oder die unter Quarantäne stehen.
5. In meinem Betrieb gab es einen bestätigten Corona-Fall. Was bedeutet das für mich?
Das kann man pauschal nicht sagen. Es liegt in den Händen der zuständigen Aufsichtsbehörden, das sind in diesem Fall die Gesundheitsämter der Länder, über die weiteren notwendigen Schritte zu entscheiden. Wie weiter oben bereits erklärt, wird jeder Corona-Fall den Behörden gemeldet und sie leiten die weiteren Untersuchungen und Maßnahmen – auch in den Betrieben der Infizierten – ein. Zunächst sollte mit bestehenden Interessenvertretungen (etwa Betriebs- oder Personalrat) oder dem Arbeitgeber gesprochen werden. Natürlich kann auch der Arbeitgeber im rechtlich zulässigen Rahmen Maßnahmen ergreifen.
6. Darf mein Arbeitgeber mich nach Hause schicken,…
-
a) …weil er meint, dass ich krank bin?
Hat der Arbeitgeber begründete Anhaltspunkte, anzunehmen, dass der Beschäftigte an Corona erkrankt ist, darf er zum Schutz des Betroffenen und der restlichen Belegschaft diesen zur Genesung nach Hause schicken. In diesem Fall kann er natürlich keine Arbeit von Zuhause aus verlangen. Bei Arbeitsunfähigkeit besteht insoweit ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall (§ 3 EFZG).
-
b) …weil er vage vermutet, dass ich krank sein könnte?
Bei Freistellung von der Arbeit aufgrund bloßer vager Vermutung des Arbeitgebers, der/die Beschäftigte könnte erkranken, befindet sich der Arbeitgeber aufgrund Arbeitsfähigkeit und Arbeitswilligkeit der/des Beschäftigten im Annahmeverzug und schuldet weiterhin Gehalt gemäß § 615 BGB.
-
c) …weil er will, dass ich vorsichtshalber von Zuhause aus arbeite?
Der Arbeitgeber hat kein Recht, über den privaten Wohnraum seiner Beschäftigten zu verfügen. Er kann also nicht einseitig Arbeit von zu Hause aus anordnen, sondern es bedarf einer Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. In der augenblicklichen Situation und um Ansteckungen zu vermeiden, kann es aber sinnvoll sein, sich über die Möglichkeiten der Homeoffice-Arbeit grundsätzlich und vermehrt zu verständigen.
7. Was ist, wenn unser Hauptgeschäftspartner beispielsweise in China sitzt und unser Betrieb massiv unter den Auswirkungen des Corona-Virus leidet. Mein Chef will den Betrieb vorübergehend schließen und die Belegschaft in den Urlaub/nach Hause schicken. Darf er das?
Wenn Unternehmen aufgrund der weltweiten Krankheitsfälle durch das Corona-Virus Kurzarbeit anordnen und es dadurch zu Entgeltausfällen kommt, können betroffene Beschäftigte Kurzarbeitergeld erhalten. Diese Leistung muss vom Arbeitgeber beantragt werden. Voraussetzung für den Bezug von Kurzarbeitergeld ist, dass die üblichen Arbeitszeiten vorübergehend wesentlich verringert sind. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn aufgrund des Corona-Virus Lieferungen ausbleiben und dadurch die Arbeitszeit verringert werden muss oder staatliche Schutzmaßnahmen dafür sorgen, dass der Betrieb vorrübergehend geschlossen wird. Ohne Kurzarbeitergeld einfach nach Hause schicken kann der Arbeitgeber seine Beschäftigten nicht ohne weiteres. Eine „Zwangsfreistellung“ gegen den Willen der Beschäftigten ist grundsätzlich nicht zulässig, denn der/die Arbeitnehmer/in hat aufgrund des Arbeitsvertrages einen Anspruch auf Beschäftigung (§§ 611, 611a BGB). Vielmehr trägt der Arbeitgeber das sog. Wirtschaftsrisiko in Form unrentabler Beschäftigung (§ 615 S. 3 BGB). Gleiches gilt für seitens des Arbeitgebers zwangsweise angeordneten Abbau von Überstunden. Die durch die Corona bedingten Auftragsschwankungen betroffenen Arbeitgeber sind auch nicht ohne weiteres dazu berechtigt, Arbeitszeitkonten mit Minusstunden zu belasten. Anders wäre es, wenn der bzw. die Beschäftigte selbst entscheiden kann, dass er oder sie weniger arbeitet, als es die Arbeitszeitregelung vorsieht. Denkbar sind allerdings tarifvertragliche oder arbeitsvertragliche Regelungen, die die Nutzung von Arbeitszeitkonten zur Überbrückung von Auftragsschwankungen vorsehen. Entschließt sich der Arbeitgeber aus freien Stücken bei bloßem vagen Corona-Verdacht oder reiner Sorge davor, den Betrieb vorübergehend zu schließen, kann er dies natürlich tun. Er muss dann aber auch in diesem Fall das Entgelt weiterzahlen (§ 615 BGB) und darf ohne ausdrückliche Vereinbarung auch hier nicht auf die Stundenkonten der Beschäftigten zurückgreifen.
8. Mein Betrieb wurde von der zuständigen Behörde unter Quarantäne gestellt und zur Schließung aufgefordert. Bekomme ich weiterhin meinen Lohn, auch wenn ich selbst nicht erkrankt bin?
Ja. Grundsätzlich tragen die Arbeitgeber auch bei den unerwarteten und von ihnen unverschuldeten Betriebsstörungen, zu denen auch die extern angeordnete Schließung des Betriebes gehört, das Risiko und damit auch die Lohnkosten (§ 615 BGB). Davon losgelöst regelt das Infektionsschutzgesetz einen Anspruch gegenüber der zuständigen Behörde auf so genannte Verdienstausfällentschädigung für jene Arbeitnehmer, die als „Ausscheider, Ansteckungsverdächtiger, Krankheitsverdächtiger oder als sonstiger Träger von Krankheitserregern“ von der Behörde mit einem beruflichen Tätigkeitsverbot belegt wurden, (§ 56 Infektionsschutzgesetzes (IfSG). Die Entschädigung in Höhe des Verdienstausfalls (in den ersten sechs Wochen) wird vom Arbeitgeber ausgezahlt, § 56 Abs.5 IfSG. Der Arbeitgeber hat gegen die Behörde dann einen Erstattungsanspruch hinsichtlich des gezahlten Verdienstausfalls. Damit aber Beschäftigte möglichst lückenlos ihr Geld erhalten, ist der Arbeitgeber insoweit verpflichtet, mit der Entschädigungszahlung in Vorleistung zu gehen – allerdings nur für die Dauer von höchstens sechs Wochen, danach zahlt die Behörde die Entschädigung direkt an die Beschäftigten aus. Falls der Arbeitgeber nicht in Vorleistung geht, zum Beispiel, weil er sich weigert, können sich Beschäftigte mit ihrem Ent-schädigungsanspruch direkt an das Landesamt/die Landesbehörde wenden. Sollten Beschäftigte im Laufe der Quarantäne tatsächlich erkranken, erhalten sie Entgeltfortzahlung bei Krankheit und anschließend (nach 6 Wochen) Krankengeld von der Krankenkasse.
9. Und was passiert mit meiner Arbeit und meinem Lohn, wenn ich persönlich unter Quarantäne stehe ohne bereits selbst erkrankt zu sein – etwa weil ich Kontakt zu Corona-Infizierten hatte?
Personen, die unter amtlich angeordneter Quarantäne stehen oder dem sogenannten beruflichen Beschäftigungsverbot nach dem Infektionsschutzgesetz unterliegen, sind von ihrer Arbeitsverpflichtung befreit.
Grundsätzlich schuldet der Arbeitgeber seinen Beschäftigten weiterhin die Vergütung, wenn sie für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in der eigenen Person liegenden Grund ohne eigenes Verschulden an der Dienstleistung gehindert ist (§ 616 S. 1 BGB). Die Rechtsprechung geht hier von einem Zeitraum bis zu von sechs Wochen aus (BGH v. 30.11.1978, III ZR 43/77). Diese Lohnfortzahlungspflicht nach § 616 BGB des Arbeitgebers kann aber durch Tarifvertrag oder Arbeitsvertrag ausgeschlossen oder reduziert werden. Zudem ist umstritten, ob der persönlicher Verhinderungsgrund auch dann greift, wenn der Grund für die Verhinderung eine Epidemie und damit ein außerhalb der persönlichen Sphäre der/des Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin liegendes Ereignis ist, das mehrere Personen betrifft. Besteht kein Anspruch auf Vergütungszahlung gegenüber dem Arbeitgeber, greift aber der Entschädigungsanspruch gegenüber dem Staat nach § 56 Abs. 1 IfSG. wie in der letzten Frage beschrieben – der Arbeitgeber tritt hier in Vorleistung, kann aber die Erstattung der Entschädigung bei der zuständigen Behörde beantragen. Zudem gilt auch hier: Beschäftigte, die selbst an Corona erkranken und dadurch arbeitsunfähig sind, erhalten nach den „normalen“ Regeln die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall (EFZG).
10. Wie steht es um meine Arbeit und meinen Lohn, wenn aufgrund des Corona-Virus der Kindergarten oder die Schule meines Kindes geschlossen hat? Kann ich dann zu Hause bleiben und bekomme ich weiterhin mein Geld?
Grundsätzlich sind Beschäftigte verpflichtet, Anstrengungen zu unternehmen, um das Kind anderweitig betreuen zu lassen. Gerade bei kleinen Kindern ist das aber bekanntlich kein Selbstläufer. Hier sollten Sie schnellstmöglich ein Gespräch mit Ihrem Arbeitgeber suchen und gemeinsam überlegen, ob etwa Arbeit von zu Hause aus in Frage kommen kann.
Erkrankt das Kind, gelten die allgemeinen Regeln: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben dann das Recht, entsprechend der einschlägigen sozialrechtlichen Regelungen eine Freistellung aufgrund der Erkrankung des Kindes in Anspruch zu nehmen. Gesetzlich vorgesehen sind insoweit bis zu zehn Tage pro Kind und Elternteil, bei Alleinerziehenden also 20 Tage (§ 45 SGB V). Ist das Kind dagegen gesund, die Kita aber zum Beispiel wegen Corona-Gefahr geschlossen und die Beschäftigten haben keine Möglichkeit, das Kind anderweitig unterzubringen, liegt aufgrund in diesem Fall – jedenfalls bei kleineren Kindern – bestehender elterlicher Sorgepflichten (§ 1626 Abs. 1 BGB) eine unverschuldete persönliche Verhinderung im Sinne von § 616 BGB vor. Dies löst dann für einen kürzeren Zeitraum (wenige Tage) einen Anspruch des Arbeitnehmers bzw. der Arbeitnehmerin auf bezahlte Freistellung aus. Allerdings ist zu prüfen, ob § 616 BGB nicht durch Tarif- oder Arbeitsvertrag ausgeschlossen wurde.
11. Welche Vorsorgemaßnahmen muss mein Arbeitgeber ergreifen, um mich vor Corona zu schützen? Welche Möglichkeiten haben Betriebsräte diesbezüglich?
Der Arbeitgeber hat gegenüber seinen Beschäftigten eine arbeitsvertragliche Schutz- und Fürsorgepflicht. Deshalb muss er dafür sorgen, dass Erkrankungsrisiken und Gesundheitsgefahren im Betrieb so gering wie möglich bleiben. Je nach Art des Betriebes – etwa in einem Betrieb mit viel Kundenkontakt – kann aus der Schutzpflicht zu einer konkreten Verpflichtung, zum Beispiel Desinfektionsmittel zur Verfügung zu stellen, folgen. Zudem sind Arbeitgeber verpflichtet, ihre Beschäftigten in Bezug auf die einzuhaltenden Hygienemaßnahmen und Schutzvorkehrungen zu unterweisen. Das bedeutet, dass den Beschäftigten erklärt werden muss, wie sie Ansteckungsrisiken minimieren. Sie können z.B. zum regelmäßigen Hände waschen angehalten werden.
Gibt es im Betrieb einen Betriebsrat oder Personalrat, sind solche Hygieneanweisungen seitens des Arbeitgebers, die in aller Regel Fragen der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Betrieb berühren, nach § 87 Nr.1 und Nr. 7 BetrVG und § 75 Abs. 3 Nr. 11 und 15 BPersVG mitbestimmungspflichtig. Der jeweiligen Interessenvertretung ist daher zu empfehlen, sehr schnell gemeinsam mit dem Arbeitsschutzausschuss nach § 11 Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) die Gefährdungslage im Betrieb zu beraten. Die gemeinsame Sitzung sollte dazu genutzt werden, um die Reihenfolge und Arbeitsteilung zu Gefährdungsbeurteilung, Unterweisung, Betriebsanweisung, genereller Information und möglichen Maßnahmen (persönliche Schutzausrüstungen) zügig in Gang zu setzen. Auch die Biostoffverordnung gibt Handlungsspielräume für die Interessenvertretungen.
12. Welche Berufsgruppen sind betroffen?
Die aktuelle Risikobewertung für die Bevölkerung in Deutschland kann beim Robert Koch-Institut eingesehen werden. Berufsbedingte Kontakte mit Corona können u.a. bei Kontakt mit infizierten Patienten in der Arztpraxis, im Krankenhaus oder beim Transport von infizierten Patienten stattfinden. Weiterhin kann ein berufsbedingter Kontakt in Laboratorien, wo Verdachtserreger untersucht werden, aber auch in der Gastronomie und anderswo erfolgen. Aus Sicht des Arbeitsschutzes ist der Umgang mit Corona und damit infizierten Personen im Gesundheitsbereich durch die vorhandenen Bestimmungen geregelt. Für Beschäftigte, die durch ihre berufliche Tätigkeit mit Infektionserregern in Kontakt kommen können, gilt u.a. die BioStoffV, deren Arbeitsschutzbestimmungen in den Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) bran-chen- und themenspezifisch konkretisiert werden. Weitere Infos
Wo finde ich Tipps zur betrieblichen Pandemieplanung?
Der Koordinierungskreis für Biologische Arbeitsstoffe (KOBAS) der DGUV hat Tipps zur betrieblichen Pandemieplanung aktualisiert und fortgeschrieben. Dieses Faltblatt informiert, was in den Betrieben festzulegen und zu veranlassen ist, wenn sich ein Krankheitserreger weltweit verbreitet. Das Faltblatt wird gemeinsam von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, dem Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte (VDBW) und dem Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit (VDSI) herausgegeben. Mehr Infos
13. Wo finde ich weitergehende Hinweise?
Bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Beim Robert Koch-Institut
Bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung